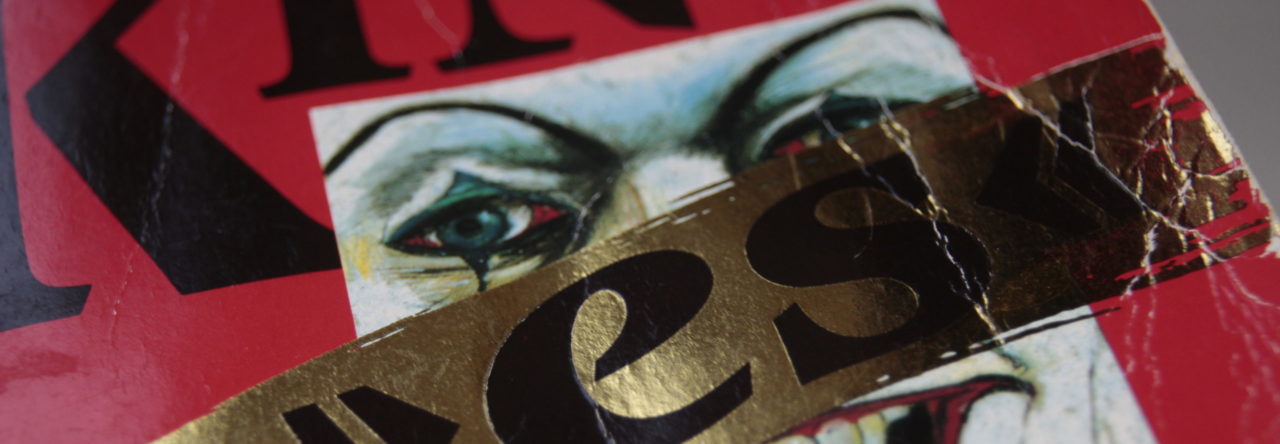[Spoiler-Warnung] 1984. Der erste Zeitsprung in die Achtziger! Für mich als Wiederleser nun endlich der Sprung der Hauptcharaktere in mein Alter? Fast jedenfalls, denn diese etwa 24 Seiten werfen ebenfalls nur erste Schatten – die Hauptfiguren lassen noch auf sich warten. Wieder ist es Wasser, das sich in Derry blutrot färbt: Das nächste Opfer ist Adrien Mellon – ein angehender Schriftsteller, dem es zum Verhängnis wird, seine Homosexualität und Liebe zur Stadt recht extrovertiert vor sich herzutragen. Das Kapitel führt vor, wie erbarmungslos Diskriminierung von homosexuellen Lebens- und Ausdrucksweisen in amerikanischen Kleinstädten praktiziert wird und als wäre das nicht gruselig genug, hat Pennywise seinen zweiten Auftritt… Auf zu einem kunterbunten Themenmischmasch!
Outsider
Der erste Gedanke, der sich zu diesem Kapitel in meinem Kopf geformt hat, hatte nichts mit meiner ersten Lektüre vor 27 Jahren zu tun, sondern mit wesentlich jüngeren »Leseerlebnissen«: Dieses Kapitel liest sich für mich wie die ersten paar 100 Seiten von Kings Roman »The Outsider«. Erst 2018 habe ich es mit Spannung gelesen und es ist mir gut in Erinnerung geblieben. Zusätzlich ist da noch eine weitere Verbindung, die mein medienverseuchtes Hirn geknüpft hat, und schon beim Outsider musste ich damals an die erfolgreiche und verstörende True-Crime-Dokumentation »Making the Murderer« denken (die noch immer auf Netflix verfügbar ist. Und nein: ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das schreibe — leider).
Meine Assoziation entstand nicht durch die Handlung, sondern durch die Technik. Kings protokollartige Erzählweise dieses Kapitels, das den Leser sozusagen mit der Polizeiakte im Mordfall Adrian Mellon bekannt macht. Aus der Perspektive der Polizisten, Zeugen und Verdächtigen wechseln wir ständig den Verhörraum und erfahren, wer (oder was) Adrian das Ende seines Lebens beschert hat. Im »Outsider« wird genau auf diese Art erzählt, allerdings mit noch sehr viel mehr Protokoll und weniger Chaos… »Nach dem Festival« weicht in weit mehr Aspekten von reiner Dokumentation ab.
Vor allem macht sich der ›klassische‹ Romanerzähler bemerkbar, wenn die Polizisten ihren eigenen Streit darüber austragen, ob der Clown nun eine tatsächlich beteiligte Person war, ein Hirngespinst oder eine faule Ausrede der Beschuldigten. Außerdem dann, wenn der Erzähler selbst wieder mit seiner Allwissenheit aufwartet, indem er die Gedanken einiger Figuren schildert. Übrigens wäre mir das damals, 1992/93, niemals aufgefallen, aber die eigentlich gute Idee des reinen Protokolls ist durch diese Abweichung plötzlich nicht mehr schlüssig und bringt mich beim Lesen tatsächlich etwas durcheinander. Womit habe ich es denn nun hier zu tun? Ist es ein Protokoll oder nicht? Außerdem sind die ständigen Sprünge zwischen den einzelnen Verhörsituationen mit ihrem wechselnden Polizei-Personal zweitweise etwas anstrengend, auch das löst King im Outsider besser – nimmt sich dafür allerdings auch deutlich mehr Zeit (soll heißen: Seiten). Genügend Raum also, jedem einzelnen Charakter ausführliche Gelegenheit zur Entfaltung zu geben. Im Verhör der verdächtigen Jugendlichen aus Derry musste ich mehrfach zurückblättern, um auseinanderzuklabüstern, welcher Polizist nun wie zum Thema Clown und Homosexualität steht. Fast wirkt der »Outsider« so, als habe King versucht, seine Fehler mit diesem frühen Versuch wieder gut zu machen, denn die Protokolle in seinem 2017er Roman funktionieren hervorragend ohne Erzähler, sind doch spannend und geben ausreichend Einblicke in die Figuren. Sehr geschickt erzählt.
Making the Murderer
Die Doku dagegen ist nicht nur beim »Wie« sondern in einem Detail erschreckenderweise beim »Was« nah an den Ereignissen, die das Kapitel beschreibt: Den Zeugenverhören um Steven Avery und Brendan Dassey. Man könnte fast (wieder einmal) meinen, Stephen King besitzt eine Zeitmaschine oder ist eine Art Prophet, der sich seine Geschichten nicht ausdenken muss, sondern irgendeinen Draht in die Zukunft hat … .
Prophecy is the gift of God and everyone has a smidge of it.
Aus Stephen Kings The Stand
2005 werden Avery und Dassey angeklagt, Teresa Halbach ermordet zu haben. Die Doku zeigt einige Verhöre, die nicht gerade so laufen, wie man sich das vielleicht so vorstellt, nach jahrzehntelangem Konsum amerikanischer Polizeiserien und -filmen. Kings Beschreibung von Steve Dubay, dem siebzehnjährigen Jungen mit einem IQ von 68, ähnelt Dassey dabei frappierend. Für Empörung bei den Zuschauern der Doku sorgte vor allem die Verhörstrategie der Polizei. Die Aufnahmen der Überwachungskamera werden teilweise ungeschnitten präsentiert und zeigen, wie offenbar versucht wird, Dassey ein Geständnis durch Einschüchterung und Vortäuschung falscher Tatsachen abzuringen. Es muss wohl als Hinweis darauf gelesen werden, dass diese Strategie auf amerikanischen Polizeistationen keine Seltenheit war, eine Art offenes Geheimnis, wenn King dem ›Halbstarken‹ Steve Dubay ähnliches widerfahren lässt. Auch er wird bedrängt; auch ihm wird ausgeredet, was er tatsächlich gesehen hat. Er ist das schwächste Glied in der Kette der Verdächtigen (und Vorverurteilten) und leicht manipulierbar.
Wenn ich jetzt an die Szene in Making a Murderer denke, die Aufnahmen aus diesem Verhörraum, überkommt mich wieder eine ähnliche Beklemmung. Natürlich ist Dasseys Unschuld umstritten und Gericht bzw. Jury haben ihn schuldig gesprochen – in den Kommentaren des YouTube-Videos wird klar, wie viele gute Argumente beide Seiten haben (anscheinend hat er sich später vor Gericht zu den medialen Vorbildern seiner Tat bekannt, doch wiederum steht nun einmal alles unter dem Generalverdacht, all das hat ihm Staatsanwaltschaft und Polizei mehr oder weniger eingeredet).
Doch allein diese Vorstellung, er könnte unschuldig sein und schlimmer noch, die Vorstellung, in diesem Alter in diesem winzigen Raum unschuldig ohne anwaltlichen oder familiären Beistand der Polizei mit ihren Versprechungen / Drohungen ausgeliefert zu sein… Polizisten, die dich nicht eher gehen lassen, bevor du nicht sagst, was sie hören wollen — das halte ich für eine wahrhaft entsetzliche Situation! Für mich ist dieses Szenario Horror, in einem Sinne, den man vielleicht nicht meint, wenn man von Horrorliteratur spricht, der ebenso allerdings bei Stephen King vorkommen könnre. Im Fall Dubay ist das etwas anders, darauf will King hier nicht unbedingt hinaus; das ist eher der Fall beim Outsider. Denn dieses absolute Mitleid kann und sollte sich Dubay gegenüber nicht einstellen – völlig unschuldig ist er nämlich nicht. Und doch klingt die Bedrohung an, wenn der Polizist Averino sagt
Erzähl uns die ganze Wahrheit, dann wird die Sache vielleicht nur halb so schlimm ausgehen. … Erzähls uns, dann lass’ ich dich auch anrufen, obwohl eigentlich nur ein einziges Gespräch erlaubt ist.
31
Ob diese Aussage so ihre Richtigkeit hat, wage ich zu bezweifeln. Dabei erfährt man nicht viel über Dubays eigene Gedanken und seine Reaktionen auf diesen Druck werden kaum beschrieben, bis auf einen gelegentlichen beunruhigten Gesichtsausdruck. Es bleibt offen, was er davon hält, dass ihm niemand die Wahrheit abkauft, dass am Ende ihrer brutalen Attacke ein Clown aufgetaucht ist, der Adrian Mellon sozusagen den Rest gegeben hat.
I ♥ Derry
Dass es soweit kommt, daran trägt Dubay eine Teilschuld – nachdem Webby Adrian ins Gesicht schlägt und sein Freund Don Haggarty um Hilfe ruft, ist es Steve Dubay, der schreit »Halt die Klappe, Schwulenschwein!« (38) Auch er beteiligt sich daran, Adrian wie »eine Strohpuppe« (39) zwischen ihm, Unwin und Webby hin und her zu stoßen und hilft schließlich, ihn ins Wasser zu werfen.
Dennoch ist es vor allem der Anführer der kleinen Bande John ›Webby‹ Garton, der das Auftreten Mellons als Affront auffasst, und voll und ganz im Klischee des Dorfschlägers aufgeht. Figuren wie Webby hat Stephen King im Laufe der Jahre zu Hauf beschrieben. Ein anderer dieser Art wird bald in den 1957er-Kapiteln seinen großen Auftritt haben – den Namen habe ich vergessen, aber ich weiß noch, dass er eigentlich diesen »Club der Verlierer« überhaupt erst ermöglicht. In der Zeitrechnung des Buches war das vor 28 Jahren. Anscheinend hat sich dahingehend die Derry-Welt nicht allzu stark weitergedreht, es gibt sie noch, die »Bullys«, immer bereit sich an allem Abweichenden so stark zu stören, dass sie sich nur noch durch Anwendung stumpfer Gewalt zu helfen wissen.
Dabei fängt es mit etwas an, das erst einmal recht harmlos klingt: den Hut, den Adrian trägt, auf dem nichts weiter steht als I ♥ Derry. Soviel war mir auch vor diesem Kapitel mit all den sehr expliziten Hinweisen über Derrys verdorbenen Charakter klar: diesen Ort zu lieben, fällt den meisten Einwohnern schwer. Das Webby sich deswegen daran stört, ist unwahrscheinlich. Er empfindet den Hut wohl ganz allgemein als »schwul« und so etwas möchte er offenbar einfach nicht sehen müssen. Das scheint zunächst einmal absurd, aber ohne mich ausführlich damit beschäftigt zu haben, ist es wohl eine recht plausible Beschreibung von Homophobie. Es ist zwar keine Phobie wie jede andere – Wikipedia nennt sie eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die demnach nicht als »krankhaft abnorm« eingestuft wird. Und doch muss man bei einem Autor wie Stephen King natürlich aufhorchen, wenn er sich mit etwas beschäftigt, dass mit Ängsten zu tun hat, immerhin hat er sich ein Kapitel Zeit genommen, um diese zu erkunden.
Wovor hat Webby dabei eigentlich Angst – ausgesprochen wird es nicht. Wie ein christlicher Fundamentalist wirkt er kaum, nichts im Text deutet darauf hin. Bei Wikipedia (entschuldigt die unzureichende Quelle) findet man dazu, dass bei Phobien wie dieser es »nicht Angst vor diesen Personen, sondern eine tiefsitzende, oft unbewusste Angst vor den eigenen unterdrückten Persönlichkeitsanteilen« ist. Webby hat nun verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen, wie das eben so bei Ängsten ist (in der Emotionsforschung nennt man das Coping). Möglich wäre da zum Beispiel: der Situation ausweichen. Webby entscheidet sich jedoch für den aggressiven Weg, vermutlich um sich und seiner Gruppe die eigene Männlichkeit zu beweisen? Wenn man das so ausspricht, klingt das eher klischeehaft und abgedroschen. Ob das als tatsächliche Motivation für reale Gewalttaten zutrifft ist fraglich, in dem, was King hier beschreibt, würde ich es aber als sein Erklärungsmodell durchaus so herauslesen.
Man muss dazu noch einräumen, dass Adrian, seinen Auftritt schon ein wenig provokant gestaltet. So sehr, dass sein Freund Don versucht, ihn davon abzuhalten. Don schwant nichts gutes, denn er kennt die Stadt besser, Adrien ist hier nicht aufgewachsen. Er zeigt ihm Graffitis, die die brutale Homophobie der Stadt bezeugen. Selbst die örtlichen Prediger sind davon nicht frei, sagt er (Derry scheint eine gesunde Evangelikale Gemeinde zu beherbergen). Doch Adrien lässt sich nicht belehren, er will bleiben, trotz der vehementen Appelle seines Freundes. Er behauptetet sogar, dass ihn die Atmosphäre der Stadt ermunterte, an seinem Roman weiterzuschreiben. Danach würden sie beide die Stadt verlassen. Für die Polizisten fasst Hagarty seine Beobachtungen zu Derry noch einmal zusammen und sie sind so ziemlich das Gegenteil von dem süßen Herzsymbol auf dem fatalen Hut:
Natürlich wußte er nicht, wie Derry wirklich ist. Er glaubte es zu wissen, aber er ist nicht lange genug hier gewesen, um auch nur eine Ahnung vom echten Derry zu bekommen. Ich habe versucht, ihn aufzuklären, aber er wollte nicht zuhören.
34
Weitere Kommentare über Derry folgen, einer davon so vulgär, dass ich ihn hier nicht wiederholen sollte, wenn ich den Blog einigermaßen jugendfrei halten möchte… Selbst die Polizisten sind irritiert über die abstrakte, obszöne Beschreibung der Stadt. Ich zitiere lieber das Entscheidende, was Don schließlich für die Polizisten entschärft und herunterbricht auf die schlichte Feststellung: »Es ist ein schlechter Ort. […] Es ist eine einzige Kloake.« Adrien warnt er in dem folgenden Rückblick, dass es in der Stadt zu viele unerkannte Irre gäbe.
Derry: Dass es mit der Stadt etwas auf sich hat, dass das aggressive Potential, das in Amerika der 80er überall schlummert, hier schneller erwacht und vielleicht in größerer Zahl als an anderen Orten, das führt King in diesem zweiten Kapitel bereits überdeutlich ein. Genauso erinnere ich es noch von meiner ersten Lektüre. Als geradezu prägend würde ich rückblickend meine »Besuche« in diesem Ort heute bezeichnen. Fortan stellte ich mir fast jede Stadt in den USA vor wie diese, vielleicht mit etwas weniger Mord und Totschlag. Später haben die Romane »Tommyknockers« und »Needful Things« diesen Eindruck natürlich zementiert. In allen drei Romanen sind es die in den Einwohnern bereits angelegten Potentiale zur Bosheit, die irgendetwas anlocken (oder durch dieses etwas erst befeuert werden?) – ein Monstrum, ein Seelenhändler, ein »es«. Hat es sich ausgerechnet Adrian als Opfer gesucht, weil er die Stadt nicht abstoßend fand, sondern mit einer positiven Haltung mit diesem Ort umgehen wollte? Ihn verstehen wollte und vielleicht dazu beitragen, ihn etwas fröhlicher zu machen? Das ist natürlich eine heute erst entwickelte Theorie, das werde ich im Auge behalten. Vielleicht sollte ich eine Art Seite einführen, auf der ich all diese Vermutungen über noch kommendes sammle und später prüfe, ob es eintrifft/zutrifft. Hier nun beobachten, welche Opfer sich Pennywise noch so herauspickt.
Wenn man etwas so ortsbezogenes liest, denkt man immer wieder über die eigene Beziehung zum eigenen Heimatort nach. Damals war das Zingst, vielleicht etwas zu klein für ein Derry, Kriminalität gab es soweit ich weiß kaum. Vielleicht einmal einen Einbruch, eine Schlägerei… an einen Mord oder vermisste Kinder kann ich mich nicht erinnern. Heute denke ich eher an Rostock und da gibt es natürlich einiges zu bedenken. Es wird den einen oder anderen Außenstehenden geben, der angesichts der Vorfälle von 1992 bei Nennung dieser Stadt ebenfalls an eine Kloake denkt, in der sich im Verborgenen die Irren nur so tummeln. Das ist nicht das Bild, das ich in meinen 20 Jahren hier von dieser Stadt gewonnen habe.
Als ich 2000 in die Stadt zog, war diese »Pogromnacht« bereits 8 Jahre her und dass ein Bewusstsein für die Geschichte entwickelte ich erst, als ich auf einem Festival mit einigen Besuchern aus den alten Bundesländern ins Gespräch kam. Die hatten natürlich einen völlig anderen Blick auf die Stadt und erschraken regelrecht, dass ich da lebte, als würde ich riskieren, jeden Abend von Pennywise gemeuchelt zu werden, wenn ich kurz den Müll runterbringe; (oder als sei ich mit Pennywise im Bunde?) Ich musste erst einmal erklären, dass ich Rostock als eine weitgehend friedliche Universitätsstadt erlebt habe, in der man eher die Präsenz der Antifa spürt als alles andere. Das jedenfalls war zu dem Zeitpunkt mein Eindruck, auf Grundlage der Stadtviertel, in denen ich mich aufhielt. Und gefährlich? Mir wurde mal ein Fahrrad geklaut, das war bis dahin alles. Ich gehe manchmal nachts spazieren und muss nicht das Geringste befürchten. In Derry würde ich das vermutlich schön bleiben lassen und selbst tagsüber immer mal wieder einen Blick nach hinten werfen. Das klingt nun ein bisschen so als wollte ich die furchtbaren Ereignisse vom August 1992 irgendwie Kleinreden, so ist das keineswegs gemeint. Mir ist zum Beispiel bewusst, dass ich der privilegiertesten Bevölkerungsgruppe angehöre, die eher selten Ziel von Diskriminierung ist und Adriens Blick auf Derry ist natürlich geprägt von seinen Erfahrungen mit den alltäglichen Anfeindungen. Ein Einwohner des Sonnenblumenhauses könnte geneigter sein, Derry für Rostock zu halten, wenn er Kings Roman läse. Alles eine Frage der Perspektive. Hier geht es nun allerdings um meine Erfahrung, meine Perspektive. Das ist eben eine völlig andere; (zumal ich das Glück habe und hatte, immer wieder mit wunderbaren Menschen aus dieser Stadt und seiner Umgebung zusammenarbeiten zu dürfen, die sich für Erinnerungskultur und beispielsweise den Kampf gegen Antisemitismus einsetzen).
Schließlich hat sich ein gewisses Derryhaftes Gefühl bei mir gelegentlich schon eingestellt. In anderem Zusammenhang: Ein Bewusstsein für (und eine Furcht vor) einen gewissen wahnsinnigen, gewaltbereiten und hirnverbrannten Bevölkerungsanteil habe ich erst in den letzten Jahren entwickelt. Schuld daran ist allgemein gesagt das Internet. Das Verhalten so vieler Menschen im Netz ist so dermaßen zum kotzen… häufig gepaart mit ihrer Berufung zum wissenschaftsleugnenden Verschwörungsideologen. Man stelle sich vor in einer Stadt zu leben, in der diese Trolle und Querdenker die Oberhand haben. Das stelle ich mir unter Derry vor, wie Adrien es beschreibt. Man muss schon fast sagen, leider gibt es diese einzelne Stadt nicht. Die könnte man ja meiden und wegziehen, wenn man das Pech hätte dort geboren zu sein. Nein, diese Derry-Einwohner tummeln sich dummerweise überall… Zwischenfazit also: Rostock stelle ich mir heute nicht vor, wenn ich von Derry lese, und damals war es auch nicht Zingst. Neukalen, eine Gemeinde mitten in Mecklenburg, gab mir immerhin die Geografie des Ortes in meinem Kopf vor; die Barrens wiederum fand ich in auf dem Darß. Dazu an anderer Stelle mehr.
Pennywise returns
Nun zur abschließenden Gruselszene. Eine erste kleine Überraschung für mich beim Wiederlesen ist wohl, dass mir der Horror-Clown schlechthin wenig Angst einjagt. Das liegt möglicherweise daran, dass es hier nicht um kleine Kinder geht, in denen ich meine eigenen Söhne erkenne. Außerdem: Die Betonung liegt so sehr auf der Situation drumherum – die ganz real wirkende Brutalität, die sich gegen Adrien Mellon richtet –, dass Pennywise dagegen irgendwie verblasst. Unheimlich bleiben seine Äußerungen, seine Fröhlichkeit angesichts dieser sinnlosen Gewalt, die sich hier gerade abspielt: hier unten schweben wir alle. Wo unten und wer ist gemeint mit »wir alle« und wieso schweben? Es bleibt rätselhaft und der beste Horror ist immer der, bei dem der Leser seiner eigenen Fantasie überlassen bleibt. Das Pennywise gerne beißt und Körperteile abtrennt ist noch in guter Erinnerung aus dem Kapitel zuvor und schockt inzwischen weit weniger.
Die Beschreibung seines Äußeren deckt sich weitgehend mit der bereits etablierten, widerspricht ihr aber auch, denn Don Hagarty sagt schließlich, Pennywise habe am Ende doch weder wie Ronold oder Beozo ausgesehen. Etwas irritierend und doch genial: wieder bleibt es dem Leser überlassen, sich seinen eigenen Fantasie-Pennywise aus den Bruchstücken der Beschreibung im Text, den herangezogenen Referenz-Clowns und der ganz eigenen Vorstellung zusammenzubasteln.
Derry Patrol
Kurz noch etwas, das mir durch den Kopf ging während ich las und was mir als »Kind« niemals eingefallen wäre darüber nachzudenken: Die Darstellung der Cops ist keine absolut positive, auch sie lassen sich zu leicht schwulenfeindlichen Äußerungen hinreißen, gehen mit den Gefangenen nicht sehr freundlich um und verwenden wie gesagt fragwürdige Verhörmethoden. Doch sie versuchen immerhin die Rechte des Opfers durchzusetzen und verurteilen die Tat als solche. Das ließ mich kurz über die für mich befremdliche Debatte nachdenken (Ende 2020), über die zu positive Darstellung der Polizei in Film, Fernsehen und Literatur. Man wollte Kinderserien wie Paw Patrol einstellen, die mein Sohn mit vergnügen sieht, in der absolut nichts weiter passiert, als das ein paar hilfsbereite Hunde jedem, aber auch jedem helfen, der in Not gerät. Wie absurd wäre es denn, wenn einer der Hunde hin und wieder eine Katze verprügelt oder sie racial profiled? Den Vorwurf jedenfalls muss Stephen King sich schon in den 90ern nicht machen, er würde die Officers hier zu geschönt dastehen lassen. Auch in Desperation hat King bereits einen ziemlich miesen »Bad Cop« auf seine Charaktere losgelassen. Eine Vertrauensperson, die zum absoluten Bösewicht mutiert, das ist natürlich eine King’sche Horrorvorstellung – die viel zu oft nicht den Romanwelten von Gruselschriftstellern vorbehalten bleibt. Nur welchen Effekt soll es haben, wenn sämtliche fiktionale Polizeifiguren nur noch Arschlöcher sind?
Eine nicht weitergedrehte Welt
Abschließend bleibt mir noch, das zu beschreiben, was mir den größten Horror an diesem Kapitel bereitet hat. Es überrascht mich selbst ein wenig, dass es nichts mit Pennywise und seinem nächsten Mord zu tun hat. Bin ich schon zu alt, um mich von so etwas noch vom Hocker reißen zu lassen? Das wäre irgendwie schade.
Das Kapitel insgesamt ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. (Romananfänge merke ich mir allgemein leichter). Die groben Abläufe und einige Details wie das Festival, die Brücke und dass es um Gewalt gegen einen homosexuellen Bürger der Stadt Derry geht. Auch einige Charaktere, abgesehen von den Polizisten. Obwohl ich meinte, dass es einen wichtigen Sherriff gab in Derry, der auch weiterhin eine große Rolle spielen wird; da muss ich mich wohl getäuscht haben, der war bisher jedenfalls nicht dabei.
Warum ist es also bei mir hängen geblieben, während ich bei vielen Kapiteln, die noch kommen werden, absolut keine Ahnung mehr habe, was mich erwartet? Vielleicht weil ich in einem Alter war, in dem ich selbst aufgrund meiner häufig rot werdenden Wangen und meinem wenig sportlichem Auftreten als schwul bezeichnet wurde – nicht als Feststellung, sondern in einer Art, die mich unabhängig vom Wahrheitsgehalt verletzen sollte, wenn mal eine Beleidigung gesucht wurde oder man sich im Rudel gegen mich durchsetzen wollte (als ob das nötig gewesen wäre…). In diesem verwirrenden Alter mitten in der Pubertät zwischen 12 und 14 ist so etwas nicht unbedingt leicht zu verkraften. Besonders wenn es einem einzureden versucht wird, mit irgendwelchen beobachteten Anzeichen (wie dieses Rotwerden). Die daraus wachsende Verunsicherung, ob da nun was dran sein könnte, macht allein schon Angst, weil man einen Vorgeschmack bekommen hat, mit welchem Level an Häme und Hänseleien man wird rechnen müssen, wenn es sich bewahrheiten sollte. Zum anderen, falls man wie ich als heterosexueller junger Mensch damit konfrontiert wird, bauen sich da die abstrusesten pubertären Ängste auf. Hier hat das Buch nicht unbedingt geholfen, meine Angst zu bekämpfen. Zum Glück gabs Dr. Sommer in der Bravo meiner Schwester.
Was mich beim Lesen damals nicht irritiert hat, machte mich heute wiederum doch sehr stutzig, beim Ordnen der Gedanken zu diesem Kapitel: Natürlich fand ich es schon 1992 verstörend, was sich in dieser kurzen Erzählung abspielte, aber keinen Moment habe ich hinterfragt, ob das realistisch sei oder nicht (oder 1986 realistisch war, als das Buch erschien). Der Reportagestil trägt natürlich dazu bei. Kein Zweifel: bis auf den Abschluss mit Horror-Clown könnte es genau so in einer Amerikanischen Kleinstadt passiert sein!
Schön wäre doch angesichts dieser realistisch-plausiblen Wahrnehmung von 1986–1992, dass man diese Szene heute 2020/21 anders lesen würde. Entweder müsste man doch den Eindruck haben, einen völlig überzogenen fiktiven Text vor sich zu haben, oder wenigstens einen Text aus alter, grauer Vorzeit, in der das Mittelalter quasi noch regierte! Wie furchtbar muss diese Welt gewesen sein, Anfang der 80er, dass ein Schriftsteller derartiges schreiben konnte! Diese Jagt auf einen harmlosen Bürger wegen seines Auftretens – war das mal glaubwürdig erzählt? Ja, das war es und leider ist es das noch ganz genau so. 27 Jahre später habe ich in Bezug auf die Welt, die ich kenne, keinen Unterschied in der Wahrnehmung dieses Kapitel machen können. Hat sich nichts geändert an der alltäglichen Gewalt gegen Randgruppen auf der Welt? Dass es kein Problem der Vergangenheit ist, und kein rein amerikansiches (oder russisches, usw.) kann man zum Beispiel hier sehen:
Aber zurück zu den USA: Googelt man »hate crimes against gays 80s« gelangt man zu der erschreckenden Wikipedia-Seite: »History of violence against LGBT people in the United States«. Die hier für 1960–2000 erfassten Verbrechen gegen LGBT sind sicherlich nicht so ausführlich dokumentiert wie die aus jüngerer Zeit und der Gegenwart. Aber dass es so viele sind, müsste eigentlich verwundern. Das ausgerechnet ein solches Kapitel so ›gut altert‹, fast ohne weitere Änderungen in der heutigen Zeit spielen könnte, nach 30 Jahren das macht heute mehr Angst, als Pennywise‘ erster, zugegebenermaßen etwas drollige Auftritt in diesem zweiten Haupthandlung-Jahrzehnt.
Schließlich: Dieser Zeitstillstandhorror, den mir dieses Kapitel bereitet hat, ist wohl der komplizierteste, der mir je begegnet ist. Verknüpft ist er mit der echten Welt, nicht so sehr mit Kings Fantasie. Vielleicht ist das ja ganz im Sinne des Autors, ein ganz spezieller Horror, der dem Buch selbst eingeschrieben ist? Immerhin ist es 27-Jahre-Derry-Zyklus, ist Zeit, die im Buch eine zentrale Rolle spielt und es würde mich nicht wundern, wenn dieses »es ändert sich nichts am menschlichen Hang aus Angst Leid zuzufügen« eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Grundannahme dafür ist. Pennywise erntet jeweils nur was die phobischen Menschen ihm servieren.
Rostock, 11.11.2020
Fragen, Kommentare, Diskussionen: usw.
https://forum.stephen-king.de/viewtopic.php?f=3&t=9170