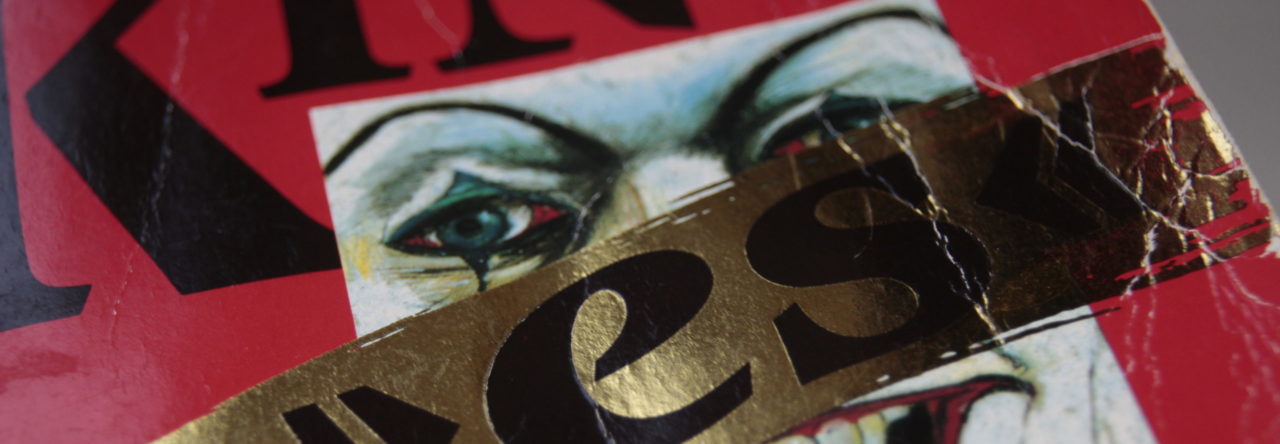Endlich kommen die Hauptrollen ins Spiel. Mike Hanlon bringt sie dazu, sich ihren geradezu ausgelöschten Erinnerungen an die Kindheit in Derry zu stellen. Dieses Kapitel besteht aus sechs separaten kleineren, die alle eines gemeinsam haben: Sie erzählen aus dem Alltagsleben der Protagonisten und beschreiben – natürlich – die Ängste, mit denen sie sich als Erwachsene herumschlagen müssen. Dabei spielen ihre Partner eine wichtige Rolle, sie stehen in irgendeiner Weise mit der Angst in Verbindung, die die gealterten Protagonisten plagt. Spoiler Warnung übrigens!
Vorab eine kleine Anmerkung: Noch stehe ich am Beginn des Projekts, aber es droht mir bereits jetzt aus dem Ruder zu laufen. Natürlich ist das folgende ein kompliziertes Kapitel. Jeder einzelne der Hauptcharaktere bekommt hier eine ordentliche Grundlage; verlockend, das alles ausführlich zu kommentieren. Während ich immer mehr Notizen gesammelt habe, ist mir klar geworden, dass es so nicht funktionieren kann. Es würde am Ende ein Blog herauskommen, der ungefähr genauso dick ist, wie das Buch selbst. Das war nicht der Plan und darum muss ich hier unbedingt Entscheidungen treffen, was weggelassen werden kann. Und was genau hier wichtig ist. Das Ergebnis: Stan Uris, denn Stan fehlt später, er ist nicht Teil der 1984er-Handlung. An seinem Unterkapitel also versuche ich alles reinzupacken und kommentiere die anschließenden in wesentlich kürzerem Umfang. Was ich zu diesen einzelnen Charakteren sagen wollte und welche Erinnerungen ich mit ihnen verknüpfe kann ich später immer noch unterbringen. Auf gehts…
1. Stan Uris nimmt ein (letztes) Bad
Stanley Uris ist einer dieser Spoiler, von einer Art wie ich sie nicht leiden kann. Die Karawane der Tapferen und Alien 3 haben es vor- bzw. nachgemacht: Wir erleben einen gewonnenen Todeskampf und im zweiten Teil werden alle Erfolge werden auf einen Schlag zunichte gemacht (ich lasse das mal so stehen, ohne zu spoilern, wen oder was in Alien und den Ewoks ich meine). King übertrumpft das noch. Hier ist es ja keine rückwirkende Entkräftung, es ist eine Vorwegnahme. Stan stirbt, er begeht Selbstmord in der Badewanne. Damit wird der kleine Stan, der mit seinen Freunden gegen das Monster in Derry ankämpft, zu einer tragischen Randfigur degradiert. Dass er sterben wird, wusste ich noch. Ich bekomme die Szene aus dem Film, in dem sein Kopf im Kühlschrank liegt und zu sprechen beginnt, einfach nicht aus dem … Kopf. An dieser Stelle wiederum keine Überraschungen für mich, was den Plot angeht. Ich wusste sogar noch, wie er es tut.
Woran ich mich überhaupt nicht erinnern konnte, ist die Ehefrau. Und vor allem, wie das Kapitel inszeniert wird. Innerhalb dieser 6 Anrufe weist es eine ganz besondere Abweichung auf. Es ist das einzige dieser Anruf-Kapitel, in denen ausschließlich indirekt über einen der zentralen Charaktere erzählt wird. Mit einer weiteren Ausnahme sind die anderen Anrufe Anlass, jeden der »Helden« schon recht ausführlich einzuführen, inklusive der sie beschäftigenden Gedanken. Es werden an Beispielen bestimmte Eigenschaften gezeigt, die Lebenssituationen zum Zeitpunkt der Haupthandlung wird umrissen und ihr Werdegang seit den Vorfällen im 1953er Derry offenbart. Die andere Ausnahme ist Mike Hanlon, der ebenfalls in diesem Kapitel fast vollständig ausgespart bleibt, doch Mike darf immerhin im anschließenden Zwischenspiel zu Wort kommen.
Aber Stan schweigt und das schließlich für immer. Sein Sprachrohr ist seine Frau Patricia, um die es eigentlich geht. Eine gewagte Entscheidung des Autors, einer nur in diesem Kapitel agierenden Figur so viel Raum zu geben und so viel Tiefe zu verleihen. Ist es ein rein künstlerisch ambitionierter Versuch, die Figur durch reine Reflexion seiner Frau hier zum Leben zu erwecken? Oder will er damit sagen, Stan ist überhaupt nicht wirklich lebendig aus Derry entkommen? Wäre es nicht langsam an der Zeit einen Helden in irgendeiner Form endlich die Bühne betreten zu lassen? Immerhin haben wir bisher Bill nur fiebrig passiv erlebt, keiner der Polizisten scheint eine wichtige Rolle zu spielen und nun kann man die erste Hauptfigur aus der dramatis personae gleich wieder streichen. Irgendwie unbefriedigend. Bisher ist all das eher eine Kurzgeschichtensammlung, zwar durchaus fesselnd, nur fehlt das Element des »Helden«. Noch ist all das zu sehr Literatur und zu wenig Unterhaltung, man fragt sich, warum King immer wieder das Gegenteil vorgeworfen wird/wurde. Gespannt bin ich vor allem darauf, wie Stan als Junge dargestellt wird. Ist er später ebenso der einzige, der keine innere Stimme hat? Ich glaube nicht, kann es aber nicht ausschließen.
Überraschend allerdings: Nichts davon hat mich damals gestört und nichts davon stört mich jetzt. Nicht als Leser. Ich registriere es. Natürlich kann sich ein 1100 Seiten Mammutwerk alle Zeit nehmen, um eine unheimlich unheimliche Atmosphäre aufzubauen. Das gelingt (für mich) besonders dadurch, dass eine ganze Weile gar nicht greifbar ist, wer überhaupt in der Lage sein könnte, sich gegen das sich ankündigende Böse in Derry aufzulehnen. Alle bisher Beteiligten leugnen entweder die Existenz dieses Bösen oder machen sich auf und davon. Die dritte Variante schließlich: sie werden zum Opfer. Jetzt ist die Frage, inwiefern Stan Uris Opfer ist. Sein Ableben mag selbst herbeigeführt worden sein, aber der Leser ist hier wirklich auf reine Mutmassungen angewiesen. Zum Zeitpunkt der Handlung ist ja längst noch nicht klar, was den Kindern 1958 widerfahren ist. Die Tat wird entsprechend von King geschickt eingesetzt, um genau das anzudeuten: ›Stan hatte einen guten (bösen) Grund, ihr werdet sehen…‹
Fluch und Segen der Schildkröte – »… aber kein Baby«
Eines haben alle Kinder schon 1957 gemeinsam, was in dem Telefonkapitel nun erstmals gezeigt wird: Sie alle sind Außenseiter, die Kinder, mit denen auf dem Schulhof (1957) keiner so recht etwas zu tun haben will: Ein Stotterer, ein Schwarzer, ein Jude, ein Dicker, ein Brillenträger und so weiter. Und sie alle werden von einem »Bully« namens Henry Bowers gejagt. Übrigens: Es gibt kein deutsches Wort, das für mich das Wort Bully (Schlägertyp, Tyrann, Rabauke…) wirklich treffend abbildet, daher bleibe ich dabei. Und alle verlassen Derry nicht lange nach den Ereignissen von 1958.
Stan zieht nach Atlanta, er ist wohlhabend, hatte immer Glück in seiner Karriere, wobei er gut ist in seinem Job. Merkwürdig daran ist, dass Stan immer zuversichtlich ist, immer positiv an die (finanzielle) Zukunft denkt, als wüsste er bereits, was auf ihn zukommt. Man nimmt in diesem Kapitel Patty, seine Frau, als Erzählerin wahr; es ist ihr demnach anscheinend etwas unheimlich: »Wieder schien Stanley fast übernatürlich zuversichtlich zu sein.« Mir schien es nun beim Wiederlesen so, dass hier eine Art faustischer Pakt in Kraft getreten ist. Achtung Riesenspoiler! Denn obwohl Stan sich an nichts aus seiner Kindheit erinnern kann, kommen die Erlebnisse in Derry offenbar Nachts bruchstückhaft wieder hervor; er redet im Schlaf: »Die Schildkröte konnte uns nicht helfen«. Hat sie es am Ende doch? Ist dieses erfolgreiche Leben, das übrigens mehr oder weniger alle der Helden führen, eine übernatürliche Belohnung der Schildkröte (oder der Macht, die hinter diesem Tiersymbol steckt)? Ist es ihre Stimme, die Stan zuflüstert, was er im Berufsleben tun oder lassen sollte?
Gleichzeitig ist ein Fluch im Spiel, denn zwar leben alle »Verlierer« wohlhabend und haben erfolgreiche Karrieren, letztendlich sind sie alle damit aber wenig glücklich. Bei Stan ist es die Tatsache, keine Kinder bekommen zu können, die das absolute Glück in der Beziehung ausbremst. Zwar haben Bill, Richie, Eddie, Ben und Beverly ebenfalls keinen Nachwuchs, nur ist das keine Thema; aus Pattys Perspektive trifft es die Familie Uris besonders hart. Stan entschuldigt sich bei ihr dafür, er weiß, dass es seine Schuld ist, sagt er, nur eben nicht warum (57).
Pattys Angst
Seine Frau empfindet diese Bemerkungen wiederum als unheimlich; gleichzeitig weiß sie instinktiv, dass er recht hat und dass mit ihm »etwas nicht in Ordnung« ist. Ihre eigene Psyche wird vor allem mit Blick auf ihre prägenden Ängste beleuchtet: Ihr Trauma, beim Abschlussball mit Diskriminierung gegen Juden konfrontiert worden zu sein, ihr weiteres Trauma, keine Kinder bekommen zu haben. Auf wenigen Seiten schafft King es, ein einigermaßen komplexes psychologisches Bild dieser Frau zu zeichnen, die im Rest des Romans, soweit ich mich erinnere, absolut keine Rolle mehr spielen wird. Dass die Ängste und Traumata aller anderen Figuren für den Roman zentral sein dürften, ist klar, denn sie alle bekommen es mit einem Monster zu tun, dass offenbar von diesen Ängsten lebt.
Ihre jüdische Scham (»sie hatte sich geschämt, sich schmutzig gefühlt, sich jüdisch gefühlt«) und ihre daraus wachsende Wut (mal auch Hass) prägen Patricia, und besonders schön finde ich das Bild des »Migräneanfalls der Seele«, der Patty zwischen diesen beiden Polen schwingend immer mal wieder überkommt. Aber wozu das alles? Versucht King hier einen weiteren Baustein im Mosaik amerikanischer Alltagsdiskriminierung unterzubringen? Vermutlich ist es das, vermutlich beschreibt er eine Welt, in der ein Monster wie dieses »es« überhaupt erst gedeihen kann, ob in Derry oder anderswo. Doch hat es auch etwas übernatürliches mit Stan zu tun? Denn wieder wird die Schildkröte erwähnt. Nicht zuletzt soll all das neugierig machen und spannend sein, und obwohl all das ziemlich deprimierend, gelegentlich auch klobig und gar nicht »horror« ist, hat das für mich funktioniert, damals wie heute. Sicherlich habe ich 1992 nicht alles davon verstanden, aber die in der Shoah gipfelnde Diskriminierung der Juden in Deutschland hatten wir damals mit Sicherheit schon im Geschichtsunterricht behandelt, vermutlich ebenso in Deutsch. Interessant und verstörend, dass es offenbar in den USA der 1960er Jahre in gewissen Kreisen ein Thema war.
Der Anruf
Übrigens bin ich mir durchaus bewusst, dass ich recht viel über Stan rede und noch 5 weitere Anrufe vor mir habe. Da es aber zum erwachsenen Stan nicht allzu viel Weiteres zu berichten geben wird, nehme ich mir hier viel Zeit und werde die anderen Anrufe nur kurz zusammenfassen, stark reduziert und komme später an geeigneter Stelle dann eher im Vergleich zu den Kindern darauf zurück.
Schön fand ich hier wiederum an der indirekten Erzählweise, dass King einen Kniff einsetzt, um nicht Stans Innerstes zu beschreiben, die Ängste und Traumata, die plötzlich nach oben kochen, als ihn Mike anruft. Es ist Patty, die seine Reaktion beschreibt, seinen Gesichtsausdruck als den eines Mannes, »der sich von der Realität löste und dabei ganz methodisch vorging, ein Tau nach dem anderen lockerte. Das Gesicht eines Mannes, der sich aus den blauen Gefilden entfernt und ins Schwarze begibt – out of the blu and into the black«. Mit einem Neill Young Zitat endet diese Passage.
Bemerkenswert außerdem: Stan liest gerade einen Roman seines alten Freundes Bill. Dass Stan nicht genau weiß, was damals geschehen ist, wie alle anderen vergessen hat, wer Pennywise ist und was er getan hat, wurde angedeutet. Er wird noch wissen, dass er Bill gekannt hat, aber eben nicht genau, was vorgefallen ist. Der Weckruf ist Mikes Anruf, die genauer Wortwahl bleibt erst einmal verborgen.
Was folgt ist das Bad zu einer ungewöhnlichen Zeit. Es sind bei solchen Szenen heute immer Disclaimer (?) Floskeln üblich, wegen der Nachahmungsgefahr. Dabei frage ich mich, ob Stans Verhalten nicht tatsächlich dem Bild einer klinischen Depression entspricht. Aber gemeint ist das alles eher anders. Nämlich als absolute Angst vor dem, was ihn in Derry erwartet. Und für mich hat dieser Effekt sehr gut funktioniert damals. Mir hat dieser Selbstmord unglaubliche Angst eingejagt und einmal mehr an all die Schauergeschichten aus der Kindheit erinnert, in denen sich dieser oder jener Nachbar in der Scheune erhängt hat. Schon als Kind habe ich mich gefragt, was einen wohl soweit bringen könnte und es hat mich fasziniert und beängstigt, da man das ganze ja wirklich täglich selbst quasi in der Hand hat, jeden Tag entscheidet man sich ja für das Leben indem man einfach aufpasst wo man hintritt. Alles andere wäre Selbstmord – nun ja so ungefähr, was ein Siebenjähriger eben so denkt.
Heute wurde ich hellhörig eher wegen des zuvor erwähnten Diskurs um das Judentum der Familie Uris. Meine Mitarbeit an einem Faltblatt und einer Karte der Denksteine in Rostock hat mir vor kurzem erst vor Augen geführt, wie viele Juden im Zuge der Verfolgung durch die Nazis in den 40er Jahren der sicheren Deportation zuvorkamen und den Freitod wählten. Ich habe mich auch gefragt, wie die jüdische Religion damit umgeht, schließlich ist es im Katholizismus ja eine unverzeihliche Sache, die Konsequenzen für das (vermeintliche) Nachleben hat (wenn ich alter Agnostiker das richtig verstanden habe). Leider hatte ich keine Zeit für umfassende Recherchen, stieß aber immerhin auf diesen Artikel aus der Jüdischen Allgemeinen, in dem es heißt: »Obwohl der ›Selbstmord‹ im Judentum absolut verpönt ist, kann man im Talmud zahlreiche Berichte über Suizide und Suizidversuche finden, bei denen weder diejenigen, die sich selbst töten, noch die Handlung oder Absicht der Selbsttötung verurteilt werden.«
Stan wird nicht unbedingt als strenggläubig beschrieben, mir geht es bei diesem Zitat und dem Artikel (https://www.juedische-allgemeine.de/religion/selbstmord-oder-selbsttoetung/) entsprechend wenig darum, welche Gedanken er sich über die Konsequenzen für seine Existenz im Jenseits gemacht haben mochte. Vielmehr finde ich einige Passagen recht interessant für grundlegende Überlegungen über den Freitod, den Stan eben gewählt hat:
Nach Einschätzung unserer Weisen geschehen Selbsttötungen aus Angst vor Folter, Entwürdigung und Qual, in psychischer Not oder bei intellektuell und geistig nicht voll zurechnungsfähigen Menschen nie »laDaat«. Beim geringsten Zweifel am freien Willen darf nicht von Selbstmord ausgegangen und dürfen die Trauerriten nicht verwehrt werden.
Stephan Probst, Jüsdische Allgemeine, 8.1.2018
(Anmerkung: Momentan finde ich nicht heraus, was laDaat bedeutet. Wer es weiß, darf sich gerne bei mir melden.)
Aus Angst also. Heute weiß ich natürlich aus Angst vor was, allerdings bei Stan nicht mehr im Einzelnen, wie er es wann mit Pennywise zu tun bekommt. Wenn man es mit diesem Zitat oben deutet, dann ist es keine Entscheidung aus freien Willen, es ist die Angst vor (seelischer und teilweise wohl ganz konkret körperlicher) Folter und Qual, die Stan dazu treibt. Und wenn es nicht mit freiem Willen geschieht, ist der Verursacher dieser Angst Schuld, und so könnte man durchaus logisch folgern, dass Stan Pennywise nächstes Opfer ist. Schließlich hat Stan den Namen seines Mörders ganz klassisch an die Wand geschrieben, anstatt einen Abschiedsbrief zu hinterlassen (was Selbstmörder wohl eigentlich tun). Selbst wenn man das Buch noch nicht kennt und keine Ahnung hat, was auf die Kinder zukommt, ist es deutlich genug, dass hier zum dritten Mal das »es« getötet hat. Dieses mal jemanden, der offenbar eine wichtige Rolle spielt in der weiteren Handlung.
King beweist wieder einmal Geschick darin, zu zeigen, dass hier niemand in Sicherheit ist, dass es keine Wohlfühl-Happy-End-Story ist. Es kann jeden jederzeit erwischen. Und hier wird es für das Experiment wiederum interessant: ich weiß es nicht mehr, ob es am Ende alle schaffen, oder nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht so ist, aber schwören könnte ich es nicht. Darauf bin ich sehr gespannt.
2. Richard Tozier macht sich aus dem Staub
Piep piep Richie. Das habe ich in einem anderen Kapitel erwähnt: dieser mir unangenehme Ausruf ist mir gut in Erinnerung geblieben. Der ploppte sogar gelegentlich in meinem Kopf auf, wenn es mal wieder in irgendeinem Film einen Richie gab. Außerdem habe ich vielleicht deswegen einige der Charaktereigenschaften Riechies nie vergessen. Er ist der Spaßvogel, der Klassenclown, das was Eddie in der Dunkle Turm ist. Das Problem: Stephen King ist kein besonders guter Comedian. Mir fällt es oft schwer, darüber zu lachen, ich finde es meist nicht lustig. Immerhin beschreibt King anständig drumherum, dass man den Witz erkennt und seine Funktion im Großen Ganzen: Kings Humor ist nicht Selbstzweck zur Unterhaltung, er soll eher das Charaktergefüge voranbringen, wenn zum Beispiel mit Gelächter reagiert wird. Und Humor ist eine wichtige Coping-Strategie, ein Mittel gegen die Angst; so einen bei sich zu haben, wenn man gegen böse Monster antritt, ist sicherlich von Vorteil, so einer zu sein, erst recht.
Trotzdem: Auf diesen Witzbold freue ich mich nur insofern als ich »es« nun im Original lese und hoffe, dass der Humor sich einfach nicht gut hat übersetzen lassen und vielleicht doch hier und da unterhaltsam ist (statt ständig fremdschämen auszulösen). Allerdings habe ich Der Dunkle Turm bereits im Original gelesen… war jetzt auch nicht gerade Ricky Gervais.
In diesem Kapitel jedenfalls, an das ich absolut Null Erinnerung hatte, ist Richie stark an Robin Williams angelegt, wie mir scheint, besonders in Good Morning Vietnam. Die offensichtliche Parallele: Ein Radiomoderator, der seine Stimmen verstellt und damit popkulturelle, gesellschaftliche (und vielleicht politische) Satire betreibt. Es gibt diese Tradition in amerikanischer Comedy, gute Stimmenimitatoren werden durchaus geschätzt und es gibt einige. Seth MacFarlane von Family Guy, Robin Williams und – Zufall? – Bill Hader. Nun wollte ich gerade ein Interview von Hader bei der (leider demnächst auslaufenden) Late Night Show von Conan O’Brien hier verlinken – und werde dies auch gleich tun. Ganz unschuldig wollte ich dies tun, als Beweis, dass dieses Stimmimitieren nun einmal zur amerikanischen Kultur gehört (auch Deutschland hat da sehr viel Talent: Stephan Kaminski, Martina Hill, Max Giermann). Dass Hader in der neuen Verfilmung mitspielt (ich habe den Film ganz bewusst wegen des Blogs bisher nicht gesehen), wurde mir erst bewusst, als ich den Clip sah und mich erinnerte wie Hader einmal auf dem gleichen Stuhl saß und Conan davon berichtete, dass er bei den Gruselszenen immer dämlich grinsen musste: Angst spielen fällt ihm schwer. Ohne es genau zu wissen, gehe ich also einmal davon aus, dass Bill Hader den Richie spielt, was dann ja eine ganz vernünftige Entscheidung ist. Hier kommt das Video:
Stimmen spielen bei King ja ohnehin eine große Rolle, die Stimmen in den Köpfen der Protagonisten. Richie trägt diese nach außen. Und er beschreibt es auch treffend, dass er damit in Rollen schlüpft, um Ängste zu bekämpfen:
Es war viel einfacher, Tapfer zu sein, wenn man jemand anderer war.
S. 66
Ein letztes Wort noch zu diesem Kapitel und Richard: Er weicht ein wenig von den anderen ab, die meist in enger Beziehung zu einer bestimmten Person beschrieben werden. Bei Richie ist es nicht eine andere Person, eher seine eigene gespaltene Persönlichkeit; höchstens noch das kurze Gespräch mit dem Programmdirektor ist eine solche Spiegelung des ungewöhnlichen, abweichenden Verhaltens (ausgelöst durch Mikes Anruf) auf das King mit dieser Strategie hinaus will.
3. Fazit und die anderen vier Anrufe
Dieses ganze Kapitel hier ist schon jetzt ein wenig ausufernd. Natürlich habe ich Notizen zu allen Anrufen. Ich bringe all das in den kommenden Kapiteln unter, in denen Ben, Bill, Eddie und Beverly noch einmal einen Solo-Auftritt bekommen. Aber hier sollen Richie und Stan erst einmal genügen, als Modell.
Auffällig ist noch, das muss ich erwähnen, dass es nur Ben und Richie sind, die keinen Ehepartner haben und nur bei Richie wird seine Angst nicht durch die Augen eines Partners gespiegelt – bei Ben ist es der Barkeeper, der die emotionalen Ergebnisse von Mikes Anruf zu sehen und spüren bekommt. Mich interessiert schon jetzt, ob Ben es später sein wird, der dieses strittige Indianerritual (Chüd?) initiiert, denn der Trick mit dem Tequila ist ebenfalls mit einer solchen Tradition verknüpft.
Die Beziehungen zu den Partnern könnte unterschiedlich nicht sein: Bill und Stan sind die einzigen mit einigermaßen intakten Ehen, Eddie erinnert mich irgendwie an Howard Wolowitz von Big Bang Theory, der ja mehr oder weniger auch ein Abbild seiner Mutter heiratet. Beverly hat es natürlich am schlimmsten erwischt. Eine furchtbare Szene, an die ich mich tatsächlich nicht erinnern konnte.
Das Anrufkapitel an sich, das Konzept, dass Mike alle anruft und damit die Erinnerungen weckt und sie zur Rückkehr nach Derry bittet, und dass allein Stan nicht zurückkehrt – diese groben Eckpunkte waren gut gespeichert. Die Art der Einführung fand ich zwar nicht überraschend, sie hat mich aber wieder überzeugt. Vor allem ist es gelungen, eine Atmosphäre der Bedrohung aufzubauen, obwohl ich ja eigentlich weiß, was auf die Figuren zukommt.
Weil mir nun kein passender Schluss einfällt, und comic relief bei diesem Thema und in diesen Zeiten recht hilfreich ist, hier noch ein paar Stimmenimmitationen von Bill Hader…
Fragen, Kommentare, Diskussionen bitte im Stephen King-Forum: